Aktualitätszone:
Unsere Kanzlei ist an folgenden Tagen geschlossen
Freitag, den 02.05.2025,
Freitag, den 30.05.2025 und
Freitag, den 20.06.2025
geschlossen ist.
Nützen Sie bitte unser Fax 01/892 00 55 42
und unsere E-Mail info@kowarik.at
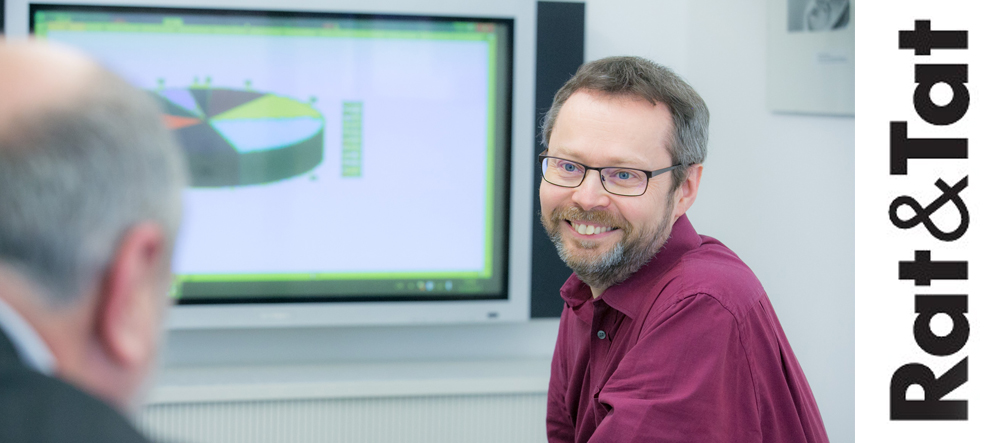
Mo - Do 8.00 bis 16.30 Uhr
Fr 8.00 bis 13.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung auch außerhalb möglich!